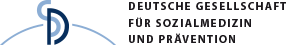Die DGSMP vergibt jedes Jahr Preise für herausragende Bachelor- und Masterarbeiten sowie Dissertationen. Die Entscheidung trifft eine Jury, deren Mitglieder Dr. Adrienne Alayli, Prof. Dr. Susanne Hartung, Dr. Janice Hegewald, Prof. Dr. Eike Quilling und Prof. Dr. Enno Swart sind. Hier finden Sie weitere Informationen über die Ausschreibungen, Voraussetzungen sowie die Bewerbungsfristen.
Preise und Ausschreibungen
Preise für herausragende Bachelor- und Masterarbeiten
Mit dem Bachelor- und Masterarbeitspreis der DGSMP werden jedes Jahr herausragende Bachelor- und Masterarbeiten ausgezeichnet. Die DGSMP prämiert die 1. Preise mit je 500 € sowie die 2. und 3. Preise mit je 300 €. Die Preisverleihung erfolgt auf der Jahrestagung der DGSMP. Die Preisträger:innen werden ein Jahr beitragsfrei als Mitglied in die DGSMP aufgenommen. Zudem übernimmt die DGSMP die Tagungsgebühr und anteilig Reisekosten zur Tagung.
Bewerben können sich Absolvent:innen aller wissenschaftlichen Disziplinen, deren Bachelor- bzw. Masterarbeit einen deutlichen Bezug zur Sozialmedizin und/oder Prävention aufweist und mit einer exzellenten Note bewertet wurde. Das Abschlusszeugnis darf höchstens aus dem Jahr vor der aktuellen Jahrestagung datiert sein.
Bewerbungsfrist ist immer zum 31. Mai des Jahres, in dem die Jahrestagung aktuell stattfindet.
Auch Nicht-Mitglieder sind antragsberechtigt.
››› Ausschreibungsflyer als PDF downloaden
››› Details zur Vergabe des Preises für eine herausragende Masterarbeit downloaden
››› Formblatt zur Bewerbung auf einen Preis für eine herausragende Masterarbeit downloaden
Preis für herausragende Dissertation
Mit dem Dissertationspreis der DGSMP wird jedes Jahr eine herausragende Dissertationsschrift auf dem Feld der Sozialmedizin und/oder Prävention ausgezeichnet. Die Preisverleihung erfolgt auf der Jahrestagung der DGSMP und ist mit einem Geldpreis in Höhe von 1.000 € dotiert. Die Preisträger:innen werden ein Jahr beitragsfrei als Mitglied in die DGSMP aufgenommen. Zudem übernimmt die DGSMP die Tagungsgebühr und anteilig Reisekosten zur Tagung.
Bewerben können sich Promovierte aller wissenschaftlichen Disziplinen, deren Dissertation einen deutlichen Bezug zur Sozialmedizin und/oder Prävention aufweist und mit einer exzellenten Note bewertet wurde. Die Promotionsurkunde darf höchstens aus dem Jahr vor der aktuellen Jahrestagung datiert sein.
Bewerbungsfrist ist immer zum 31. Mai des Jahres, in dem die Jahrestagung aktuell stattfindet.
››› Ausschreibungsflyer als PDF downloaden
››› Details zur Vergabe des Preises für eine herausragende Dissertation downloaden
››› Formblatt zur Bewerbung auf einen Preis für eine herausragende Dissertation downloaden
Posterpreise der DGSMP
Hier finden Sie die Preisträgerinnen und Preisträger der vergangenen Tagungen:
Posterpreise der Jahrestagung 2016 in Essen
1. Platz
Michael Meyer
Thema: Gesundheitsparameter als Prädiktoren der motorischen Fähigkeiten von Grundschulkindern?
2. Platz
Katja Lehmann
Thema: Erste Erfahrungen mit einem Fehlermeldesystem in Pflegeeinrichtungen
3. Platz
Francisca Then
Thema: The Cognitive Functioning of Socially Isolated Individuals may Profit from High Mental Work Demands
Martin Schäfer
Thema: Modellgestützte Schätzung des relativen Risikos vermeidbarer Sterblichkeit auf Kreisebene in der Metropolregion Rhein-Ruhr unter Berücksichtigung von räumlichen Effekten und ökologischen Kovariablen
Posterpreise der Jahrestagung 2015 in Regensburg
Poster 110
Norbert Lübke
Thema: Versorgungsforschung braucht Sozialmedizin: dargestellt am Beispiel von Daten des BARMER GEK-Pflegereports 2013 zu: „Reha vor und bei Pflege“
Poster 148
Robynne Sutcliffe, Susanne Moebus
Thema: Zusammenhang zwischen städtebaulichen Strukturen und der gesundheitlichen Lage im Ruhrgebiet – erste Ergebnisse einer kartographischen Darstellung
Poster 221
Miriam Engels, Anja Vervoorts, Simone Weyers
Thema: Einführung in eine geschlechtersensible Medizin mit der Geschlechterbrille – ein deutschsprachiges Instrument für den Einsatz in der medizinsoziologischen Lehre
Poster 248
Kathrin Gürlich, Caroline Herr, Lana Hendrowarsito, Nicole Meyer, Gabriele Bolte, Uta Nennstiel-Ratzel, Stefanie Kolb
Thema: 10-Jahresrückblick der Gesundheits-Monitoring-Einheiten: Assoziation zwischen häuslicher Passivrauchexposition und regionalen Unterschieden in berichteten Asthma, Atemwegs- und Allergieerkrankungen bei Einschülern in Bayern
Poster 341
Romy Lauer, Dorothea Kesztyüs, Reinhold Kilian, Jürgen M. Steinacker
Thema: Kosten-Effektivität des Gesundheitsförderprogramms “Komm mit in das gesunde Boot” in Grundschulen in Baden-Württemberg
Posterpreise der Jahrestagung 2013 in Marburg
1. Platz
Anja Seidel, Marion Michel, Steffi G. Riedel‐Heller
Thema: „Zufriedenheit behinderter und nicht behinderter Mütter mit der medizinischen Betreuung während der Geburt“
2. Platz
Julia Roeper, Marina Otten, Margrit Schreier, Adele Diederich – Jacobs University Bremen – DFG Forschergruppe FOR655
Thema: „Eigenverantwortung als Priorisierungskriterium: Sollten Personen mit einer ungesunden Lebensweise höhere Krankenkassenbeiträge zahlen?“
3. Platz
Roland Büchter, Dawid Pieper
Thema: „Stigmatisierung und Diskriminierung gegenüber Menschen mit psychischen Erkrankungen: Was wir trotz zahlreicher Literatur noch immer nicht wissen“
Posterpreise der Jahrestagung 2012 in Essen
1. Platz
Annika Gottschling-Lang
Thema: „Evaluation eines Interventionsprogramms zur Prävention motorischer Entwicklungsgefährdungen bei 3‐ bis 6‐Jährigen in Kindertageseinrichtungen in Mecklenburg‐Vorpommern (M‐V): Ergebnisse des Modellprojekts ‚Kinder in Kitas (KiK)‘“
2. Platz
Christine Emrich
3. Platz
Christiane Patzelt
Thema: „Hausarzt versus Krankenkasse Effektivität und Kosteneffektivität von Zugangswegen am Beispiel des präventiven Hausbesuchs“
Preisträgerinnen 2024
Dissertationspreis
Dr. Kathrin Steinbeißer
Long-term care in community-dwelling older adults in Germany: needs and approache
 Was haben Sie untersucht?
Was haben Sie untersucht?
Wir leben in einer Gesellschaft des längeren Lebens. Dies geht neben den positiven Entwicklungen auch mit Herausforderungen einher. Dabei ist es zentral, die Bedürfnisse und Bedarfe der älteren Lebensphase genau zu kennen, um die begrenzten Ressourcen im Gesundheitssystem passgenau einsetzen zu können. Ich habe dafür Personengruppen ≥65 Jahre untersucht, welche im häuslichen Setting („community-dwelling“) leben und auch unabhängig von einem Pflegegrad Unterstützungsleistungen in Anspruch nehmen. Dabei habe ich mehrere Messzeitpunkte sowie auch vulnerable Subgruppen analysiert.
Was wollten Sie in Ihrer Arbeit herausfinden?
Meine kumulative Dissertation widmete sich drei zentralen Zielen mit folgenden Fragestellungen:
1. Erkennung besonderer Pflegebedarfe: Welche geschlechtsspezifischen Determinanten stehen im Zusammenhang mit einer Inanspruchnahme informeller und formeller Pflege?
2. Identifikation präventiver Ansätze im Bereich Bewegung: Welchen Zusammenhang haben verschiedene Bewegungsarten (z. B. Spazierengehen) mit einer Inanspruchnahme von Pflege?
3. Kosteneffektivität von Pflegeleistungen: Ist eine nicht-pharmakologische Intervention („MAKS-Therapie“) in der Tagespflegeeinrichtung im Vergleich zur Standardbehandlung kosteneffektiv?
Was sind die zentralen Ergebnisse Ihrer Arbeit?
Meine Arbeit identifizierte relevante Pflegebedarfe älterer, zuhause lebender Menschen (Paper 1) sowie Ansätze für deren bedürfnisorientierte und passgenaue Pflege (Paper 2 und Paper 3). Damit lenkt meine Dissertation erstmals einen umfassenden Blick auf die Personengruppe in Deutschland, die unabhängig von einem Pflegegrad pflegerische Unterstützung in Anspruch nimmt und häufig in einer „Zwischenstation“ vor dem Übergang in das offizielle Pflegesystem ist, welche mit einem erhöhten personellen und finanziellen Mittelbedarf einhergeht.
Die Hauptergebnisse zeigen, dass höhere Alter, Multimorbidität und Behinderungsgrad die zentralen Determinanten für eine Inanspruchnahme von Pflege sind, wobei Männer mehr Pflegezeit in Anspruch nehmen und bei Alleinleben häufiger auf formelle Pflegeleistungen (z. B. professionelle Haushaltshilfen) zurückgreifen. Regelmäßige und gemäß WHO als ausreichend definierte Bewegung, insbesondere Sport kombiniert mit Spazierengehen, steht im Zusammenhang mit einer reduzierten Inanspruchnahme von Pflegeleistungen. Gleichzeitig konnte ein großes Defizit bei der Erfüllung der Nationalen Bewegungsempfehlungen bei älteren Menschen identifiziert werden.
Die MAKS-Pflegetherapie, eine nicht-pharmakologische Intervention in Tagespflegeeinrichtungen, verbesserte nachweislich die Alltagskompetenz und kognitiven Fähigkeiten der Teilnehmenden und war dabei kosteneffektiv im Vergleich zur Kontrollgruppe.
Letztlich gibt die Arbeit älteren Menschen eine wertschätzende Bühne. Denn sie stehen für all diejenigen, die unsere Gesellschaft bereichert haben und weiterhin bereichern werden. Und nun oder in naher Zukunft Unterstützung benötigen, um in Würde altern zu können.
1. Platz Masterarbeitspreis
Paulina Sell
Environmental Burden of Disease due to Long-Term Nitrogen Dioxide Exposure in Germany

Was haben Sie untersucht?
Ich habe die ursachenspezifische Krankheitslast untersucht, die in Deutschland in den Jahren 2010 bis 2021 auf die Exposition gegenüber Stickstoffdioxid (NO₂) zurückzuführen ist. Dabei habe ich die Methode der umweltbedingten Krankheitslast verwendet, welche von der WHO entwickelt wurde.
Was wollten Sie in Ihrer Arbeit herausfinden?
Mein Ziel war es, herauszufinden, wie viele Menschen in diesem Zeitraum an NO₂-bedingten Erkrankungen gelitten haben, wie viele gestorben sind und wie viele gesunde Lebensjahre verloren gingen. Auch der zeitliche Verlauf der Krankheitslast hat mich interessiert.
Was sind die zentralen Ergebnisse Ihrer Arbeit?
Ich habe festgestellt, dass die NO₂-Belastung allgemein zurückging, sie jedoch häufig noch über den neuen WHO-Empfehlungen lag und liegt. Parallel dazu sank auch die attributable (also zurechenbare) Krankheitslast. Die gesundheitlichen Endpunkte, für die ich die umweltbedingte Krankheitslast berechnet habe, waren Asthma, chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD), Diabetes Typ 2, ischämische Herzkrankheit, Lungenkrebs und Schlaganfall. Ich habe berechnet, dass 2021 ca. 100.000 verlorene gesunde Lebensjahre auf NO2 zurückzuführen waren. Das ist zwar weniger als die Feinstaub-Krankheitslast mit ca. 230.000 verlorenen gesunden Lebensjahren im Jahr 2021, aber immer noch sehr viel. Da es sich um statistische Berechnungen auf bevölkerungsebene handelt, können die Ergebnisse nicht auf Individuen übertragen werden.
Besonders interessant war, dass die Ergebnisse recht stark von den verwendeten Eingangsdaten abhängen, was ich in Sensitivitätsanalysen herausfand. Daraus konnte ich ableiten, wie wichtig die Transparenz und die ausführliche Diskussion der verwendeten Methoden und Eingangsdaten bei Krankheitslaststudien sind. Ich konnte mit meiner Arbeit zeigen, dass unsere Luft noch sauberer werden muss, um die Gesundheit der Bevölkerung effektiver zu schützen.
2. Platz Masterarbeitspreis
Simone Spangler
Gründe für die Partizipation am Drachenbootsport bei Brustkrebserkrankung – physiologische und psychologische Aspekte

Was haben Sie untersucht?
156 Brustkrebs-Überlebende im Alter von 37 bis 73 Jahren aus der Drachenboot-Community in Deutschland wurden mit standardisierten Fragebögen in einem korrelativen Querschnittsdesign befragt, wobei die gesundheitsbezogene Lebensqualität mit dem Short Form Health Survey (SF-36) und die Motive zur Teilnahme am Drachenbootsport mit dem Berner Motiv- und Zielinventar (BMZI) gemessen wurden.
Was wollten Sie in Ihrer Arbeit herausfinden?
Die Studie befasst sich mit der Frage, inwieweit sich der Gesundheitszustand auf die Motive zur Teilnahme am Drachenbootsport bei Brustkrebs auswirkt und prüft die Hypothese, ob eine geringere gesundheitsbezogene Lebensqualität (QOL) zu einer stärkeren Ausprägung der Motive führt.
Was sind die zentralen Ergebnisse Ihrer Arbeit?
Ein geringeres psychisches Wohlbefinden (β = -0.31, p = .013) sowie ein geringeres körperliches (β = -0.24, p = .035) und soziales Funktionieren (β = -0.23, p = .046) führten zu einer vermehrten Nutzung des Drachenbootfahrens zur Ablenkung von Problemen und zum Stressabbau. Zudem führte das Erleben einer geringeren Lebensqualität in Bezug auf starke und häufige Schmerzen zu einem ausgeprägteren Motiv für Ästhetik (β = -0.25, p = .011). Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Paddler*innen das Drachenbootfahren in erster Linie als emotionsorientierte Bewältigungsstrategie nutzen, um sich von Stress und gesundheitlichen Problemen abzulenken. Je geringer ihre gesundheitsbezogene Lebensqualität in Bezug auf Schmerzen ist, desto mehr nutzen sie zudem die sinnorientierte Bewältigungsstrategie über das Motiv der Ästhetik. Aus den Ergebnissen lassen sich wertvolle Implikationen für die langfristige Rekrutierung sowie für das gezielte Training von Paddler*innenn ableiten, zum Beispiel im Rahmen von spezifischen Train-the-Trainer-Programmen.
3. Platz Masterarbeitspreis
Marina Martin
Das Gesundheitswesen im Spannungsfeld zwischen Vertrauen und Verschwörungstheorien

Was haben Sie untersucht?
In meiner Masterarbeit habe ich die Rolle von Verschwörungstheorien im Rahmen der COVID-19-Proteste in Sachsen, mit besonderem Fokus auf das Gesundheitswesen, anhand der Grounded Theory untersucht. Dazu habe ich über mehrere Monate teilnehmende Beobachtungen der Proteste gemacht und narrative Interviews mit Personen geführt, die die Infektionsschutzmaßnahmen zumindest teilweise kritisierten und den Protesten unterschiedlich nahestanden. Unter den sieben interviewten Personen waren sechs Mediziner*innen aus Sachsen.
Was wollten Sie in Ihrer Arbeit herausfinden?
Zwei zentrale Forschungsfragen waren 1. die Rolle von Verschwörungstheorien im Protestgeschehen und 2. die Rolle des Gesundheitswesens.
Was sind die zentralen Ergebnisse Ihrer Arbeit?
Die Arbeit ergab, dass Personen umso stärker zu Verschwörungstheorien neigen, je mehr sie an den Protesten teilnahmen. Zudem konnte durch die Interviews konkret nachvollzogen werden, wie Radikalisierung funktioniert und sich die Weltanschauungen der teilnehmenden Personen im Laufe der Zeit verändern. Dabei wurde durch die Teilnahme an den Protesten ein verschwörungstheoretisch gefestigtes Weltbild aufgebaut, die Welt dabei zunehmend als feindlich wahrgenommen und antisemitische sowie rechtspopulistische Haltungen normalisiert. Diese Überzeugungen begünstigen auch Extremismus und Gewaltbereitschaft. Allerdings konnten auch Schutzfaktoren, wie soziale Kontakte, identifiziert werden. Zudem wurde ersichtlich, dass Personen aus dem Gesundheitswesen, die dem wissenschaftlichen Konsens folgten und z.B. geimpft haben, vielfältigen negativen Konsequenzen, wie Bedrohungen und Diffamierungen, ausgesetzt waren. Zeitgleich kommt ihnen eine besondere Rolle zu, da sie als Expert*innen besonderes Gehör finden und zu unterschiedlichsten Menschen Kontakt haben. So zeigte sich auch, dass Personen aus dem Gesundheitswesen, die an den Protesten teilnahmen, darin eine herausgehobene Stellung einnehmen.
Preisträgerinnen 2025
Dissertationspreis
Dr. Laura Maaß
Multidisciplinary measuring of maturity and readiness in national digital public health systems: The digital public health maturity index
Was habe ich untersucht:
Meine Dissertation beschäftigte sich mit den übergeordneten Fragestellungen, was Digital Public Health ist, wie es sich von dem dominierenden Terminus Digital Health unterscheidet und wie ein Instrument zur Bestimmung der digitalen Reife eines Gesundheitssystems gemäß Public-Health- und sozialmedizinischem Ansatz aussehen müsste.
Was wollte ich in meiner Arbeit herausfinden:
Bisherige Reifegrad-Instrumente beschäftigten sich primär mit der Implementierung digitaler Anwendungen im Gesundheitssystem und der rechtlichen Regulierung auf Datenschutzebene. Weitere relevante Aspekte (wie z.B. die digitale Gesundheitskompetenz oder Verfügbarkeit von Internet oder Strom) wurden weitestgehend vernachlässigt. Mein Ziel war daher zu ermitteln, welche Indikatoren für ein Reifegrad-Instrument von Relevanz sind, um die vier multidisziplinären übergeordneten Domänen
1) Technische Infrastruktur,
2) Rechliche Regulierung und politische Unterstützung,
3) Soziale Bereitschaft und Nutzungskompetenz sowie
4) Implementierung digitaler Anwendungen in der Regelversorgung abbilden zu können.
Was sind die zentralen Ergebnisse meiner Arbeit:
Von zentraler Bedeutung für meine Arbeit war ein Scoping Review, in welchem die Charakteristiken von 179 digitalen Public-Health-Interventionen sowie ihrer Anwendungsfelder herausgearbeitet wurden. Darüber wurde klar, dass auch eher im klinischen Kontext genutzte Interventionen wie die elektronische Patient:innenakte oder Telemedizin für präventive Aufgaben der Gesundheitsversorgung genutzt werden. Darauf aufbauend schlug ich mit Kolleg:innen vor, digitale Public Health Interventionen als solche Anwendungen zu definieren, welche Informations-Kommunikations-Technologien nutzen, um mindestens eine essentielle Public-Health-Funktion (gemäß der WHO) anzusprechen. Idealerweise werden sie hierbei co-creativ mit der Zielgruppe entwickelt. Darauf aufbauend wurden anschließend in einer Delphi-Studie und einem narrativen Review grauer Literatur 286 Indikatoren identifiziert, welche zur Analyse des Reifegrades digitalisierter Gesundheitssysteme beitragen können. Damit wurde der Digital Public Health Maturity Index (DiPHMI) entwickelt, welcher das Herzstück meiner Arbeit bildet.
In meiner jetzigen Beschäftigung als Postdoc am Leibniz ScienceCampus Digital Public Health Bremen soll der DiPHMI weiterentwickelt werden. Beispielsweise sollen die Anzahl der essentiellen Indikatoren basierend auf Expert:innenkonsens reduziert und ein Gewichtungssystem der übergeordneten Domänen eingeführt werden, um die Aussagekraft künftiger Erhebungen zu verbessern.
Link zur Dissertation (Open Access): https://media.suub.uni-bremen.de/entities/publication/64e30e7e-14c1-4561-bf38-c4d3a1a9689a
1. Masterarbeitspreis
Hilâl Yücesoy
Einfluss von Rassismuserfahrungen auf den Zugang zur mentalen Gesundheitsversorgung – Eine qualitative Untersuchung mit teilstandardisierten Interviews
Was habe ich untersucht?
Das Forschungsinteresse konzentrierte sich auf die Untersuchung gesundheitlicher Ungleichheit in Bezug auf die Versorgung von Personen mit Rassismuserfahrungen. Als rassifiziert markierte Personen erfahren besonders häufig Ausgrenzung und Alltagsdiskriminierung. Diese Erfahrungen werden auch in Einrichtungen der Gesundheitsversorgung gemacht. Internationale Ergebnisse zeigen, dass wiederkehrende rassistische Diskriminierungen psychische Erkrankungen begünstigen. In Deutschland existieren kaum wissenschaftliche Arbeiten zur Beziehung zwischen Rassismuserfahrungen und mentaler Gesundheitsversorgung. Diese Studie basiert auf einem qualitativen Forschungsdesign und wurde mithilfe von semistrukturierten Leitfadeninterviews (n=6) mit als rassifiziert markierten Personen der sogenannten zweiten Migrant*innengeneration in Deutschland durchgeführt.
Was wollte ich in meiner Arbeit herausfinden?
Das Ziel dieser wissenschaftlichen Arbeit bestand darin zu untersuchen, inwiefern Rassismuserfahrungen eine Rolle im Zugang zur mentalen Gesundheitsversorgung spielen und welche Maßnahmen erforderlich sind, um einen gerechten Zugang für eine diversitätssensible Versorgung zu realisieren.
Was sind die zentralen Ergebnisse meiner Arbeit?
Die Ergebnisse bestätigen verschiedene Barrieren, die den Zugang zu und die Inanspruchnahme von mentaler Gesundheitsversorgung durch rassifizierte Personen in Deutschland erschweren. Die Studie ergibt, dass auch in der mentalen Gesundheitsversorgung in Deutschland Rassismuserfahrungen gemacht werden.
In dieser Forschungsarbeit konnten Hauptbarrieren auf der Mikro- als auch der Makroebene im Zugang zur mentalen Gesundheitsversorgung von Personen mit Rassismuserfahrungen identifiziert werden. Als Barrieren wurden unter anderem ein Mangel an People of Color-Psychotherapeut*innen, das Fehlen von Informationen zum Zugang zu mentalen Gesundheitsangeboten, das Fehlen von Therapieplätzen sowie Stigmata innerhalb der Communities genannt. Cultural Safety wurde als eines der Hauptbedarfe herausgestellt. Um Barrieren abzubauen, werden den Akteuren in der Gesundheitspolitik und-praxis folgende Empfehlungen gegeben: Diversifizierung des Personals der mentalen Gesundheitsversorgung, Erhöhung der Verfügbarkeit mentaler Gesundheitsversorgung und Verankerung einer rassismussensiblen Ausrichtung, Mehrsprachigkeit und interkulturelle Kompetenz in der mentalen Gesundheitsversorgung.
2. Masterarbeitspreis
Susanne Mayer
Geschlechtervorstellungen in Zeiten eines erstarkenden Rechtspopulismus: Implikationen für die Frauen*gesundheit
Was habe ich untersucht?
Vor dem Hintergrund der aktuellen politischen Entwicklungen habe ich Geschlechtervorstellungen im Rechtspopulismus untersucht – speziell das Frauen*bild der Partei AfD – sowie mögliche Implikationen für die Frauen*gesundheit im Falle einer AfD-Regierungsbeteiligung.
Was wollte ich in meiner Arbeit herausfinden?
Ich wollte für den Fall einer AfD-Regierungsbeteiligung herausfinden, welche politischen Entscheidungen auf Basis des Frauen*bilds der Partei zu erwarten sind und welche konkreten gesundheitlichen Auswirkungen sich aus diesen Entscheidungen für Frauen* ergeben könnten.
Was sind die zentralen Ergebnisse meiner Arbeit?
Ich habe Bundestagsdebatten der 21. Legislaturperiode mithilfe der Qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring ausgewertet. Die Ergebnisse, gewonnen durch die Interpretation vor allem latenter Sinngehalte, weisen darauf hin, dass die Partei AfD Frauen* vornehmlich häusliche Rollen zuschreibt, wie die Rolle der Mutter* und Erzieherin*.
Für die gesundheitlichen Auswirkungen ergeben sich daraus ambivalente Schlussfolgerungen:
Einerseits lassen sich aus einer häuslichen Rolle positive Gesundheitseffekte ableiten, da ein Fokus auf die Hausfrauen*rolle aufgrund der oft schweren Vereinbarkeit von Familie und Beruf entlastend wirken kann. Andererseits kann der Verzicht auf eine Erwerbstätigkeit zu ökonomischer Abhängigkeit und Altersarmut führen, was zahlreiche Erkrankungen begünstigen kann. Weiterhin kann eine Verfestigung weiblicher* Geschlechterstereotype, die im Falle einer AfD-Regierungsbeteiligung ebenfalls zu erwarten ist, zu einem Rückschritt bei der Geschlechtergleichstellung führen, sodass sich die Partizipation von Frauen* in Wirtschaft und Politik möglicherweise verringert und diverse Gender Gaps sowie Gewalt gegen Frauen* potentiell zunehmen. Somit sind im Falle einer Regierungsbeteiligung der AfD überwiegend negative Gesundheitseffekte für Frauen* zu erwarten.
Dies zeigt Handlungsbedarf im Hinblick auf eine verstärkte Sensibilisierung und Aufklärung über diese Aspekte auf.
3. Masterarbeitspreis
Helena Grüter
Integrated health, social and educational services for children and young people from families with addiction and mental health problems: a qualitative analysis for the Düsseldorf area
Was habe ich untersucht?
In meiner Masterarbeit habe ich integrierte Angebote für Kinder und Jugendliche aus psychisch oder suchtbelasteten Familien im Raum Düsseldorf untersucht, die über die Bereiche Gesundheit, Soziales und Bildung integriert sind. Als methodischen Ansatz nutzt die Studie semistrukturierte Interviews mit Entscheidungstragenden und Fachkräften aus den genannte Bereichen im Raum Düsseldorf.
Was wollte ich in meiner Arbeit herausfinden?
Mit dieser Arbeit wollte ich herausfinden, wie integrierte Angebote in Düsseldorf gestaltet sind und welche förderlichen bzw. hemmenden Faktoren es für sektorenübergreifende Integration gibt. Angelehnt an ein Framework, welches verschiedene Dimensionen sektorenübergreifenden Integration sowie unterstützende Strukturen unterscheidet, beantwortet das Projekt die folgende Forschungsfrage: Wie ist die Integration bei Angeboten für Kinder und Jugendliche aus Familien mit psychisch oder suchtbelasten Eltern im Raum Düsseldorf gestaltet und was sind förderliche bzw. hemmende Faktoren für die Integration?
Was sind die zentralen Ergebnisse meiner Arbeit?
Die Ergebnisse der Arbeit bestehen in Empfehlungen zur stärkeren Einbindung von Facharbeitskreisen in Steuerungsgremien sowie zur Reduktion von Überschneidungen in Zuständigkeiten. Empfohlen wird zudem, Synergien zwischen Ausschüssen zu nutzen und eine sozialräumlich abgestimmte Angebotsplanung mit langfristig gesicherten und flexiblen Finanzierungsstrukturen aufzubauen. Weitere Empfehlungen betreffen vereinfachte Antrags- und Einstellungsverfahren, faire Bezahlung, einheitliche Schulungsprogramme und verbesserte Arbeitsbedingungen zur Unterstützung der Fachkräfte. Ergänzend wird die Einführung standardisierter Datenmanagementsysteme vorgeschlagen, um einen sicheren und effizienten Datenaustausch zu gewährleisten. Insgesamt werden eine stärkere sektorenübergreifende Vernetzung, der Abbau bürokratischer Hürden und gezielte Fachkräfteförderung als zentrale Maßnahmen für eine nachhaltige sektorenübergreifende Zusammenarbeit hervorgehoben.